Die Lösungssuche für Künstliche Intelligenz ähnelt der Auswahl betriebswirtschaftlicher Software. Zunächst stehen die Ziele und die Datenqualität im Vordergrund. Die passende Anwendung ist dann oft eine Kombination mehrerer Technologien.
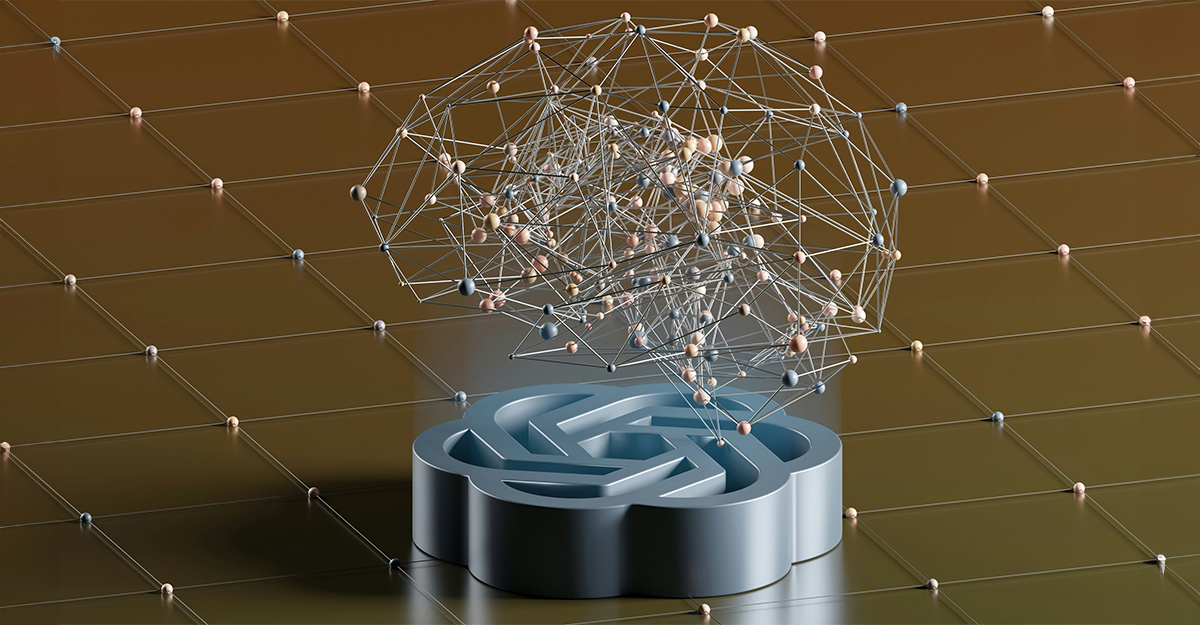
Hybride KI-Lösungen: Mit der Künstlichen Intelligenz ist es wie mit Fahrzeugen: Eine perfekte Kreuzung aus Traktor, Sportwagen, LKW und Gabelstapler, die in allen Bereichen erste Plätze belegt, gibt es nicht – und es kann sie auch nicht geben. Auch wenn die Medien bei Large-Language-Modellen (LLMs) ständig neue Benchmark-Rekorde vermelden und Gerüchte eine baldige allgemeine Superintelligenz (AGI) suggerieren, muss man eines festhalten: Eine Künstliche Intelligenz, die alle Aufgaben hervorragend beherrscht, ist aktuell nicht in Sicht.
Anwendungen wie ChatGPT, Claude, Mistral und Aleph Alpha haben alle Stärken und Schwächen. Das liegt an der Programmierung, am Training und den Trainingsdaten. Sie unterscheiden sich auch in der Ausrichtung: Claude ist für Programmierer oft die beste Wahl, ChatGPT bietet Reasoning-Modelle, die angeblich tief nachdenken können, und Aleph Alpha glänzt durch Transparenz, Erklärbarkeit sowie EU-Konformität.
Am Anfang steht die Zieldefinition
Die Angst, dass Unternehmen angesichts der großen Vielfalt keine für die eigenen Herausforderungen perfekt geeignete intelligente Lösung finden können, ist unbegründet. Mit der richtigen Modellwahl, den für die Aufgaben relevanten Daten, Metriken und den passenden Algorithmen lassen sich intelligente Systeme sehr wohl für eigene Use Cases zuschneiden.
Als Vorbereitung der Lösungsauswahl müssen sich Unternehmen über die Ziele klar werden, die sie mit Künstlicher Intelligenz erreichen wollen. Geht es um Texterstellung, fachliche Prüfung, Automatisierung von Prozessschritten, Zusammenfassung und Auswertung von User-Feedback oder Wissensmanagement? Hierbei gilt es auch festzulegen, welche Anwendergruppe welche Informationen oder Funktionen benötigt. Sollen die intelligenten Systeme lediglich Wissen vermitteln oder auch Aktionen ausführen? So ist beispielsweise eine große Detailtiefe für einen Fachspezialisten auf oberster Unternehmensebene eher nicht erwünscht. Schließlich muss auch klar definiert sein, welche Funktionen das Gesamtsystem letztendlich beherrschen soll.
Anzeige

KI-basierte Software-Auswahl
Mit smartRFI bringen Sie Tempo und Struktur in Ihre Software-Vorauswahl:
- KI-gestützte Erstellung professioneller RFIs
- Assistentin TIA hilft bei Anforderungen & Struktur
- Anbieter liefern vergleichbare Antworten mit Kostenschätzung
- Schnellere Shortlist dank klarer Entscheidungsgrundlage
Der zweite Schritt ist die Datenpflege
Die zweite wichtige Frage ist: Welche Daten besitzt mein Unternehmen, in welcher Qualität und Aktualität? Liegen sie so vor, dass es keine widersprüchlichen Dubletten gibt und die Algorithmen damit problemlos arbeiten können? Die nächste Hürde sind die Zugriffsrechte: Unternehmensdaten unterliegen häufig unterschiedlichen Sicherheitsstufen wie etwa geheim, Verschlusssache, personenbezogen oder nur für bestimmte Abteilungen bestimmt. Im Standard können große Sprachmodelle derartige Berechtigungskonzepte nicht abbilden. Hier bieten sich hybride Ansätze mit einer analytischer Künstlichen Intelligenz an. Das System prüft dann im ersten Schritt, auf welche Daten ein Nutzer überhaupt zugreifen darf. Nur wenn für die erforderlichen Informationen die passenden Berechtigungen vorhanden sind, nutzt das Sprachmodell diese Daten für seine Antworten herangezogen.
Häufig liegen Daten in Silos vor. Eine konsolidierte Plattform wäre optimal, aber auch verteilte Quellen lassen sich anzapfen, um wertvolle Zusammenhänge zu erkennen. Erst die Verknüpfung von beispielsweise Marketing-, Shop-, Finanz- und Nutzungsdaten schafft echten Mehrwert. Ohne diese Integration besteht das Risiko, dass die Künstliche Intelligenz auf einer unvollständigen Basis arbeitet – oder im schlimmsten Fall falsche Informationen „halluziniert“.
Hybride KI-Lösungen sind oft im Vorteil
Sind die Ziele festgelegt und die nötigen Daten verfügbar, geht es an die Auswahl der Technologie. Dazu gehört das passende Large-Language-Modell (LLM), das die besten Ergebnisse im Hinblick auf die festgelegten Ziele bringt. Oft reicht das allerdings nicht aus, weil die Modelle für generative Künstliche Intelligenz nicht auf Exaktheit ausgerichtet sind. Diese Eigenschaft bekommt man häufig erst mit Systemen für analytischer Künstlicher Intelligenz und Machine-Learning-Systemen, die auf großen Datenmengen operieren.
Die große Kunst besteht darin, diese beiden Technologien zu einer hybriden Lösung zu verbinden, sodass sie einerseits die für die Aufgabe relevanten eigenen Daten verwendet und nicht halluziniert, andererseits aber so einfach zu befragen und zu bedienen ist, wie wir es mittlerweile schon von Chatbots gewohnt sind.
Implementierungspartner leiten Projekte
Unternehmen sollten daher nicht darauf warten, dass bei Künstlicher Intelligenz die eierlegende Wollmilchsau auf den Markt kommt, die alle ihre Probleme löst, ohne dass sie Arbeit investieren müssen. Die Systeme und Technologien, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln sind allerdings längst verfügbar. Sie sind inzwischen auch für mittelständische und kleinere Unternehmen bezahlbar.
Erfahrene Implementierungspartner bieten mit modularen Technologiebausteinen maßgeschneiderte souveräne Lösungen, die sowohl den spezifischen Unternehmensanforderungen als auch den Compliance-Vorgaben des EU AI Acts gerecht werden. jf
Der Autor

Prof. Dr. Heiko Beier ist Geschäftsführer des IT-Anbieters moresophy und Professor für Medienkommunikation mit über 25 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Datenanalyse und Automatisierung von Geschäftsprozessen.



