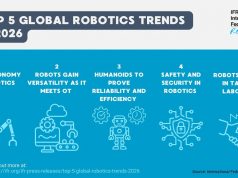Industrie 5.0 lautet der neue Zielbegriff in der Fertigung. Es geht um Fabriken, in denen digitale Zwillinge eigenständig agieren. In Asien setzt sich dieses Konzept durch. Europäische Betriebe, die nicht nachziehen, fallen zurück, warnt die German Technology & Engineering Corporation.

Industrie 5.0: „Autonome Fabriken sind in Asien auf dem Vormarsch und werden sich in den nächsten Jahren mit Verzögerung auch in Europa ausbreiten“, berichtet Karlheinz Zuerl, CEO der German Technology & Engineering Corporation (GTEC): „Europa rühmt sich gerne der Fortschritte beim Thema Industrie 4.0, aber Asien ist längst darüber hinaus auf dem Weg zur Industrie 5.0.“ Dieser Begriff bezeichnet menschenleere Produktionshallen, in denen ausschließlich Roboter aktiv sind. Möglich werden derartige Fabriken durch die Kombination aus IT, Vernetzung, Künstlicher Intelligenz, Robotik und neuartigen Fertigungsverfahren.
Europa redet sich Industrie 4.0 schön
Den Bestand bei Industrie-Robotern verzeichnet der World Robotics-Report 2024 der International Federation of Robotics. Weltweit arbeiten demnach rund 4,3 Millionen Industrieroboter in Fabriken. Das ist ein historischer Höchststand. 2023 wurden mehr als 540.000 neue Roboter installiert, über die Hälfte davon (51 Prozent) in China. Auf Europa entfielen lediglich 17 Prozent aller Neuinstallationen. In Deutschland, dem größten europäischen Markt für Industrieroboter, war ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von lediglich 7 Prozent zu verzeichnen.
„In Europa und vor allem in Deutschland neigen Wirtschaftsexperten dazu, den Erfolg von Industrie 4.0 mit wenig aussagekräftigen Zahlen schönzureden“, warnt der CEO der German Technology & Engineering Corporation. So sei in Studien der Branchenverbände Bitkom und VDMA die Rede davon, dass etwa 65 Prozent der Unternehmen in Deutschland Industrie-4.0-Technologien nutzten. „Das klingt gut, ist aber völlig belanglos, weil jedes Gerät mit WLAN-Anschluss dazugezählt wird.“
BMW ist 4.0, Tesla 5.0, China bereits 4.5
Es sei bezeichnend, dass das BMW-Werk in Dingolfing als Stolz der deutschen Autoindustrie gelte, weil sich dort seit 2024 fertig produzierte Autos ohne Fahrer zur Qualitätskontrolle bewegen. „Die BMW-Fahrzeuge folgen externer Sensorik – sie fahren nicht autonom“, erklärt Zuerl. „Im Gegensatz dazu bewegen sich Teslas in Fremont völlig selbstständig vom Band zum Logistikbereich.“ BMW ist auf dem Stand von Industrie 4.0, Tesla bei Industrie 5.0. Viele chinesische Hersteller liegen in diesem Szenario bei 4.5 oder besser.“
Der Abstand wird sich zuungunsten Deutschlands weiter verschlechtern, befürchtet der GTEC-Chef und verweist auf den Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA), der für 2025 ein schwaches Jahr für Roboterinstallationen prognostiziert. Für 2026 bestehe Hoffnung auf eine leichte Erholung.
In Asien dominieren digitale Zwillinge
Völlig anders sieht die Situation laut Zuerl in der asiatischen Fertigungsindustrie aus: „Dort erleben wir einen Run auf Autonomous Production Twins, also digitale Zwillinge, die Produktionsprozesse autonom überwachen, steuern und optimieren.“ Ein Autonomous Production Twin kombiniert Echtzeitdaten, Künstliche Intelligenz und fortschrittliche Vernetzung, um ein virtuelles Abbild der Produktion zu erzeugen. Dieses System trifft selbstständig Entscheidungen und passt Prozesse an. „Ein autonomer digitaler Zwilling kann Fertigungsprozesse aktiv steuern und auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren, etwa durch Umplanung bei Materialengpässen“, schildert der GTEC-Chef.
Anzeige | Fachartikel im IT-Matchmaker.guide Industrie 4.0 Business Lösungen
|
|||||||||||||
Der Erfolg dieser digitalen Zwillinge in asiatischen Fertigungsbetrieben zeigt sich in beeindruckenden Zahlen: „Die menschenleeren Fabriken senken die Betriebskosten um bis zu 25 Prozent, steigern die Produktivität um bis zu 30 Prozent und reduzieren gleichzeitig die Fehlerquoten um bis zu 40 Prozent“, veranschaulicht Zuerl die hohe Wettbewerbsfähigkeit der asiatischen Industry-5.0-Produktion. Westliche Industrieunternehmen sollten dieses Konzept übernehmen, wenn sie nicht zurückfallen wollen.
Diese Vorgehensweise biete sich nicht nur für Autohersteller an, sondern auch für Maschinen- und Anlagenbauer. Bei der Errichtung einer autonomen Fabrik entfielen zwar etwa ein Drittel der Gesamtkosten auf Sensorik, Software und Infrastruktur, aber die höheren Investitionen machten sich nach Berechnungen der German Technology & Engineering Corporation bereits im ersten Betriebsjahr durch die deutlich gesunkenen Lohnkosten bezahlt. Hinzu käme die höhere Flexibilität, um auf Marktveränderungen zu reagieren, und das höhere Qualitätsniveau. Das senke die Kosten für Nachbesserungen und steigere die Kundenzufriedenheit. Jürgen Frisch