Weniger Zauberstab, mehr Schraubenschlüssel: Prof. Dr. Volker Gruhn plädiert im Umgang mit Künstlicher Intelligenz für mehr Realismus. Überzogene Marketing-Aussagen verhindern, dass Unternehmen die Chancen und Grenzen der Technologie erkennen.
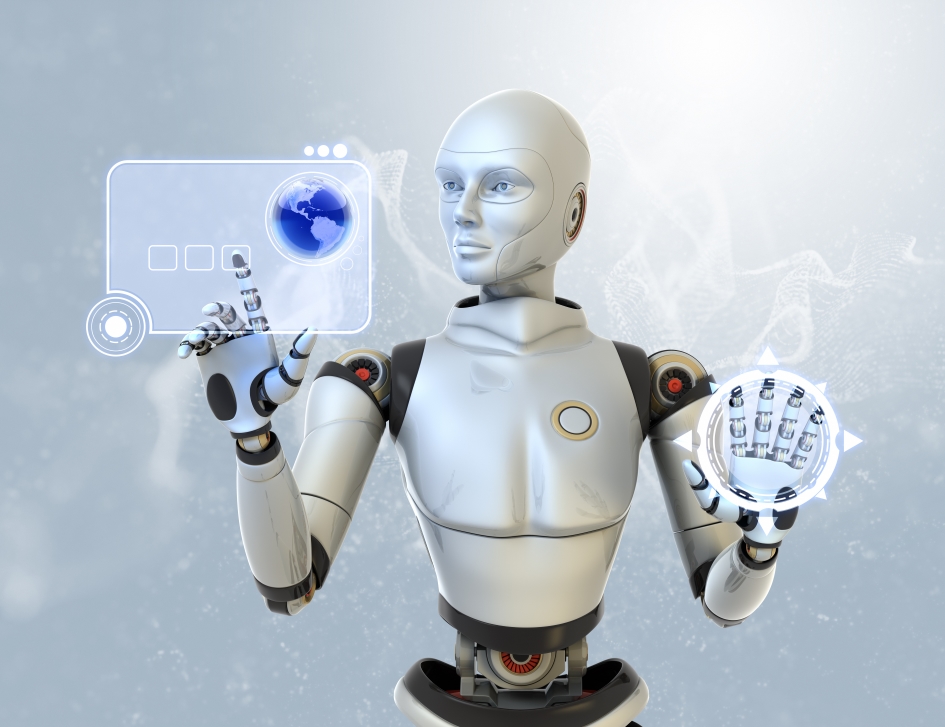
Wenn Ihre Wetter-App bei 28 Grad ein T-Shirt und bei 2 Grad einen Schal empfiehlt, ist das schon Künstliche Intelligenz? Geht es nach den überbordenden Angeboten und vollmundigen Versprechungen auf dem IT-Markt, gibt es darauf nur eine Antwort: ja. Aktuell wird so manches simple Regelwerk zu einer Software in den Himmel gejazzt. Der Stempel „Künstliche Intelligenz“ sorgt für Aufmerksamkeit bei Kunden und Investoren. All das Getöse rund um Möglichkeiten und Funktionen bringt allerdings zwei unschöne Effekte mit sich: Zum einen das Überhören des echten Fortschritts, der manchmal leise und unspektakulär daherkommt. Zum zweiten das Überhöhen der vermeintlichen Fähigkeiten, die intelligente Anwendungen mitbringen. Am Ende entsteht der Eindruck, Künstliche Intelligenz sei nur eines dieser Hype-Themen, die Analysten und IT-Dienstleister regelmäßig durch die Dörfer treiben. Schon mehren sich die Befürchtungen, dass sich bald nur noch Experten aus der Forschung für das Thema interessieren, und sich Unternehmen enttäuscht abwenden.
Die schroffe Ablehnung ist allerdings genauso wenig angebraucht wie die Überhöhung. Wenn es darum geht, das Potenzial Künstlicher Intelligenz einzuschätzen, stehen wir noch ganz am Anfang. Diese Technologie ist eben kein Zauberstab, sondern vielmehr ein Schraubenschlüssel. Ein Werkzeug, das für bestimmte Aufgaben passt.
Nicht immer ist das drin, was drauf steht
Ohne Daten keine Künstliche Intelligenz. Dieser Satz ist schlicht und wahr. Daten sind die Voraussetzung dafür, dass Anwendungen ihre Stärken ausspielen: Muster identifizieren, Voraussagen treffen. Daraus lässt sich aber keineswegs ableiten, dass alles, was auf Daten basiert, automatisch Künstliche Intelligenz ist. Sonst sind wir schnell bei dem Eingangsbeispiel mit Schal und T-Shirt. Intelligenz setzt die Fähigkeit zum Lernen voraus. Bei Künstlicher Intelligenz geht es um Maschinelles Lernen. Anwendungen, die starr aus einer Menge Regeln Schlussfolgerungen ableiten, erzielen damit spektakuläre Ergebnisse. Genau so funktionieren die meisten Software um uns herum. Aber erst die Möglichkeit, sich zu verbessern, rechtfertigt das Label „Intelligenz“.
Diese Intelligenz hat nur wenig mit den kognitiven Fähigkeiten zu tun, die wir Menschen uns zuschreiben. Wenn wir über Künstliche Intelligenz reden, ist stets die sogenannte schwache Künstliche Intelligenz gemeint. Es geht dabei um das Lösen konkreter Anwendungsprobleme: Ist das ein Stoppschild? Wie wahrscheinlich ist ein Maschinenausfall? Für das Bewältigen dieser Aufgaben wenden die Anwendungen Strategien an, die intelligent erscheinen. Sie operieren mit Wahrscheinlichkeiten und verbessern ihre Leistungsfähigkeit im Laufe der Nutzung. Aber – und das ist eine große Einschränkung – das funktioniert nur für eng definierte Einsatzszenarien. Eine starke Künstliche Intelligenz, die mit der Bandbreite des menschlichen Spektrums mithalten kann, ist auf absehbare Zeit ausschließlich ein Thema für Philosophen. So schnell werden wir mit unseren Staubsaugerrobotern nicht über den letzten Bundesligaspieltag diskutieren.
Marketing lässt Lösungen intelligent erscheinen
Mit nüchternem Blick entpuppen sich viele Themen vermeintlicher Künstlicher Intelligenz als die Kombination aus klassischer Software und geschicktem Marketing. Zum Beispiel Robotic Process Automation: Software-Roboter imitieren die menschliche Interaktion mit Anwendungen, beispielsweise für Eingaben ins ERP-System (Enterprise Respurce Planning) oder für Softwaretests. Was aussieht wie intelligentes Verhalten ist keineswegs Künstliche Intelligenz. Dass im Namen das Wort „Robotic“ vorkommt, reicht dafür nicht aus. Es handelt sich bei Robotic Process Automation vielmehr um Oberflächenintegration. Softwaretechnisch ist das bedenklich, weil die Anwendungen bei strukturellen Änderungen immer wieder angepasst werden müssen. Immerhin lassen sich derartige Anwendungen schnell realisieren. Zum Beispiel Chatbots: Der Großteil der dialogbasierten Anwendungen spult starr die vorgegebenen Skripte ab. Entdeckt der Bot in einer Anfrage die Begriffe „Service“ und „Nummer“, antwortet er „Unseren Service erreichen Sie unter 0800 XXXXX“. Selbst dann, wenn der Kunde leicht verzweifelt geschrieben hat: „Seit drei Tagen warte ich auf einen Rückruf. Euer Service ist echt eine Nummer.“
Statt Werbe-Profis sind IT-Experten gefragt
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Robotic Process Automation kann gute Dienste leisten. Chatbots spielen in Serviceprozessen auf breiter Front eine Rolle. Und es gibt lernfähige Dialogsysteme, die in ihren Aufgabengebieten nuancierte Gespräche führen. Aber in den allermeisten Fällen steckt keine Künstliche Intelligenz unter der Motorhaube, sondern klassische Softwareingenieurskunst. Es geht nicht darum, Anwendungen auszugrenzen, ihre Bedeutung zu schmälern oder die Komplexität ihrer Entwicklung kleinzureden. Es geht darum, sich ernsthaft mit den Möglichkeiten und Grenzen Künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Nur dann treffen die Verantwortlichen bei der Wahl des Werkzeugs die richtige Entscheidung.
Es gibt genug Probleme, bei deren Lösung bewährte Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz helfen. Welche das sind, das sollten bei den Anbietern und Beratern vermehrt die IT-Experten und weniger die Marketingspezialisten entscheiden. Sonst beginnt der Herbst der Künstlichen Intelligenz, noch bevor es so richtig Sommer war.
Der Autor
 Prof. Dr. Volker Gruhn ist Lehrstuhlinhaber für Software Engineering an der Universität Duisburg-Essen und Aufsichtsratsvorsitzender von adesso.
Prof. Dr. Volker Gruhn ist Lehrstuhlinhaber für Software Engineering an der Universität Duisburg-Essen und Aufsichtsratsvorsitzender von adesso.



